
Entgegen der verbreiteten Annahme ist Sucht keine moralische Schwäche, sondern eine tiefgreifende neurobiologische Erkrankung. Dieser Artikel erklärt, wie Sucht das Gehirn quasi „entführt“, indem sie überlebenswichtige Lern- und Gewohnheitsmechanismen umprogrammiert. Das Verständnis dieses Prozesses ist der Schlüssel, um Stigmatisierung abzubauen und Betroffenen sowie Angehörigen einen wirksamen Weg zur Heilung aufzuzeigen.
Jeder, der einen geliebten Menschen im Griff einer Sucht erlebt hat, kennt die zermürbende Mischung aus Sorge, Frustration und Ohnmacht. Immer wieder hört man gut gemeinte Ratschläge wie „Du musst es nur wollen“ oder „Reiss dich doch einfach mal zusammen“. Doch diese Appelle an die Willenskraft prallen meist wirkungslos ab und hinterlassen bei allen Beteiligten nur noch mehr Schuld und Unverständnis. Die gängige Vorstellung, Sucht sei eine Frage der Disziplin oder des Charakters, ist nicht nur falsch, sondern auch schädlich. Sie nährt das Stigma und baut eine Mauer des Schweigens um die Betroffenen.
Die Wahrheit ist weitaus komplexer und liegt tief in der Biologie unseres Gehirns verborgen. Wenn wir von Sucht sprechen, müssen wir verstehen, dass wir es mit einem erlernten und sich selbst verstärkenden Prozess zu tun haben, der die rationale Steuerung ausser Kraft setzt. Es handelt sich um eine neurobiologische „Entführung“, bei der die ältesten und mächtigsten Teile unseres Gehirns – jene, die für Gewohnheiten, Belohnung und Überleben zuständig sind – die Kontrolle übernehmen. Die Sucht ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen rückgängig machen kann, sondern eine Krankheit, deren Mechanismen verstanden werden müssen, um sie behandeln zu können.
Dieser Artikel wird Sie durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse führen, die dieses Krankheitsmodell untermauern. Wir werden die feinen Unterschiede zwischen verschiedenen Suchtformen beleuchten, die fatalen Phasen der Abhängigkeitsentwicklung nachzeichnen und die verheerende Rolle von Scham und Verleugnung aufdecken. Vor allem aber werden wir zeigen, warum die Akzeptanz der Sucht als Krankheit der unumgängliche erste Schritt auf dem langen, aber möglichen Weg zur Genesung ist.
Um die komplexen Zusammenhänge von Abhängigkeit besser zu verstehen, gliedert sich dieser Artikel in klare Abschnitte. Sie führen von den Grundlagen über die psychologischen Hürden bis hin zu den neurobiologischen Vorgängen im Gehirn.
Inhaltsverzeichnis: Die Suchtkrankheit verstehen und überwinden
- Wenn das Verhalten zur Droge wird: Der Unterschied zwischen Stoff- und Verhaltenssüchten
- Warum wird man süchtig? Das Zusammenspiel von Genen, Psyche und Umfeld
- Der schleichende Weg in die Sucht: Die 4 Phasen, die fast jeder Betroffene durchläuft
- Die Mauer des Schweigens: Warum Scham das grösste Hindernis im Kampf gegen die Sucht ist
- Ohne Einsicht keine Heilung: Warum die Akzeptanz der Krankheit der erste Schritt zur Genesung ist
- Die Anatomie des Verlangens: Was im Gehirn bei Sucht passiert
- „Ich habe alles im Griff“: Die Psychologie der Verleugnung bei Suchterkrankungen
- Die Psyche im Griff der Sucht: Wie Abhängigkeit das Denken, Fühlen und die Persönlichkeit verändert
Wenn das Verhalten zur Droge wird: Der Unterschied zwischen Stoff- und Verhaltenssüchten
Wenn wir an Sucht denken, kommen uns meist Bilder von Alkohol oder Drogen in den Sinn. Doch das Krankheitsbild ist weitaus breiter und umfasst Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen mögen. Die moderne Suchtforschung unterscheidet grundlegend zwischen stoffgebundenen Süchten (z.B. Alkohol, Nikotin, Kokain) und nicht-stoffgebundenen oder Verhaltenssüchten (z.B. Glücksspiel, pathologischer Internetgebrauch, Kaufsucht). Der entscheidende gemeinsame Nenner ist nicht die Substanz, sondern der Kontrollverlust und der zwanghafte Drang, ein bestimmtes Verhalten trotz negativer Konsequenzen fortzusetzen.
Der neurobiologische Mechanismus ist in beiden Fällen erschreckend ähnlich: die Aktivierung des Belohnungssystems im Gehirn. Während natürliche Belohnungen wie Essen oder Sex den Dopaminspiegel moderat anheben, können Drogen diesen Prozess dramatisch kapern. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass der Konsum von Alkohol den Dopaminausstoss um 50 bis 100 % steigern kann, während die Wirkung bei manchen Drogen noch weitaus drastischer ist: Kokain sogar um 1.000 % erhöht die Ausschüttung des Botenstoffs. Diese unnatürlich starke Stimulation führt dazu, dass das Gehirn das Suchtmittel oder -verhalten als überlebenswichtig einstuft.
Bei Verhaltenssüchten ist der Effekt subtiler, aber nicht weniger gefährlich. Die ständige Verfügbarkeit von „Belohnungsklicks“ in sozialen Medien, die Spannung beim Online-Glücksspiel oder der Rausch beim exzessiven Shopping können das Gehirn in ähnlicher Weise trainieren. Ein prägnantes Beispiel ist die exzessive Nutzung von Plattformen wie TikTok. Eine Studie ergab, dass die durchschnittliche Person bereits 2021 täglich 89 Minuten auf der App verbrachte. Experten warnen, dass eine solche Nutzung zu Veränderungen im Gehirn führen kann, die die Konzentrationsfähigkeit, das Setzen von Prioritäten und den Aufbau realer sozialer Beziehungen beeinträchtigen. Die Droge ist hier nicht chemisch, sondern das Verhalten selbst.
Warum wird man süchtig? Das Zusammenspiel von Genen, Psyche und Umfeld
Die Frage, warum eine Person süchtig wird und eine andere nicht, lässt sich nicht mit einer einfachen Antwort klären. Die Vorstellung eines „Suchtcharakters“ ist ein Mythos. Stattdessen beschreibt die Wissenschaft Sucht als eine multifaktorielle Erkrankung, die aus einem komplexen Zusammenspiel dreier zentraler Bereiche entsteht: der genetischen Veranlagung, der psychischen Konstitution und den sozialen Umfeldfaktoren. Niemand ist von Geburt an zum Süchtigen bestimmt, doch manche Menschen tragen ein höheres Risiko in sich.
Genetische Faktoren können die Anfälligkeit für Sucht erheblich beeinflussen. Studien zeigen, dass beispielsweise die Art und Weise, wie der Körper Alkohol verstoffwechselt oder wie sensibel das Gehirn auf Dopamin reagiert, teilweise erblich ist. Dies erklärt, warum Suchterkrankungen in manchen Familien gehäuft auftreten. Doch Gene sind kein Schicksal. Sie sind vielmehr der Bauplan, der durch psychische und soziale Einflüsse aktiviert oder eben nicht aktiviert wird. Zu den psychischen Risikofaktoren zählen unter anderem traumatische Erlebnisse, chronischer Stress, geringes Selbstwertgefühl oder andere psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Die Sucht wird hier oft zu einem unbewussten Versuch der Selbstmedikation, um schmerzhafte Gefühle zu betäuben.
Schliesslich spielt das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle. Wächst ein Kind in einer Familie auf, in der regelmässiger Alkoholkonsum zur Normalität gehört, oder gerät ein Jugendlicher in einen Freundeskreis, in dem Drogenkonsum als Statussymbol gilt, erhöht dies das Risiko signifikant. Die Verfügbarkeit der Substanz und der soziale Druck können den Anstoss geben. Aktuelle Daten aus Deutschland verdeutlichen die gesellschaftliche Relevanz: Laut dem DHS Jahrbuch Sucht 2024 konsumierten rund 4,5 Millionen Erwachsene (8,8 %) Cannabis, wobei Männer doppelt so häufig einen problematischen Konsum aufweisen wie Frauen. Sucht ist somit nie das Ergebnis einer einzigen Ursache, sondern das unglückliche Resultat eines „perfekten Sturms“ aus biologischer Prädisposition, seelischer Belastung und sozialem Kontext.
Der schleichende Weg in die Sucht: Die 4 Phasen, die fast jeder Betroffene durchläuft
Abhängigkeit entsteht selten über Nacht. Sie ist vielmehr ein schleichender Prozess, ein Weg, der oft mit Neugier und Genuss beginnt und in Zwang und Kontrollverlust endet. Experten beschreiben diesen Weg typischerweise in vier Phasen, die zwar nicht immer trennscharf sind, aber eine wichtige Orientierung bieten, um die Entwicklung einer Sucht zu verstehen. Das Erkennen dieser Phasen ist sowohl für Betroffene als auch für Angehörige ein entscheidendes Werkzeug zur Einschätzung der Situation.
Alles beginnt mit der Experimentier- oder Genussphase. Hier macht die Person erste, meist positive Erfahrungen mit der Substanz oder dem Verhalten. Der Konsum ist sporadisch, die Kontrolle ist vollständig erhalten. In der zweiten, der Gewöhnungsphase, wird der Konsum regelmässiger und integriert sich in den Alltag. Das Feierabendbier wird zum Ritual, der Joint am Wochenende zur festen Gewohnheit. In dieser Phase beginnt die Toleranzentwicklung: Das Gehirn passt sich an, und es wird eine höhere Dosis benötigt, um den gleichen Effekt zu erzielen. Neurobiologisch passiert hier bereits eine entscheidende Weichenstellung.
Fallbeispiel: Die neurobiologische Verschiebung zur Gewohnheit
Studien zeigen, dass bei zunehmender Abhängigkeit die Aktivierung im Gehirn vom ventralen Striatum, dem Lustzentrum, in das dorsale Striatum wandert. Dieser Bereich ist für automatisch ablaufende Handlungsmuster und Gewohnheiten zuständig. Aus dem bewussten Streben nach einem Belohnungsgefühl („Ich will das jetzt“) wird eine unbewusste, fest verdrahtete Routine („Ich tue das einfach“). Das Gehirn baut sozusagen eine „Gewohnheits-Autobahn“, die den Griff zur Flasche oder zum Smartphone zum automatisierten Standardprogramm macht.
In der dritten Phase, der Missbrauchs- oder Schädigungsphase, treten die ersten negativen Konsequenzen auf. Trotz Problemen bei der Arbeit, Streit mit dem Partner oder gesundheitlichen Beschwerden wird weiter konsumiert. Der Kontrollverlust wird spürbar, Vorsätze scheitern. Die letzte Stufe ist die Abhängigkeits- oder Suchtphase. Der Konsum ist nun zwanghaft. Er dient nicht mehr dem Genuss, sondern primär der Vermeidung von Entzugserscheinungen. Das gesamte Denken, Fühlen und Handeln kreist um die Beschaffung und den Konsum des Suchtmittels. Der Betroffene ist gefangen im Teufelskreis.
Aktionsplan: Die 4 Phasen der Sucht erkennen
- Erste Berührungspunkte (Experimentierphase): Listen Sie alle Situationen, Kontexte und Gründe auf, in denen der Erstkontakt mit der Substanz oder dem Verhalten stattfand. Was war die ursprüngliche Motivation?
- Bestandsaufnahme der Routine (Gewöhnungsphase): Inventarisieren Sie die Häufigkeit, die Rituale und die typischen Auslöser des Konsums. Ist ein klares Muster erkennbar?
- Konsequenzen-Check (Missbrauchsphase): Konfrontieren Sie den Konsum ehrlich mit bereits eingetretenen negativen Folgen in den Bereichen Gesundheit, Beruf, Finanzen und soziale Beziehungen.
- Kontrollverlust-Analyse (Abhängigkeitsphase): Identifizieren Sie konkrete Momente, in denen der Konsum nicht mehr steuerbar war, Versuche zur Reduktion scheiterten oder Entzugssymptome auftraten.
- Handlungsplan zur Kurskorrektur: Definieren Sie auf Basis der Analyse einen konkreten ersten Schritt. Das kann das Aufsuchen einer Beratungsstelle, ein Gespräch mit einem Arzt oder eine bewusste Verhaltensänderung sein.
Die Mauer des Schweigens: Warum Scham das grösste Hindernis im Kampf gegen die Sucht ist
Obwohl die Wissenschaft ein klares Bild zeichnet, kämpft die Gesellschaft weiterhin mit einem tief verwurzelten Missverständnis: der Gleichsetzung von Sucht mit moralischem Versagen. Dieses Stigma erzeugt eine toxische Atmosphäre aus Scham und Schuld, die für Betroffene oft ein grösseres Hindernis darstellt als die Sucht selbst. Die Angst vor Verurteilung, sozialer Ausgrenzung und dem Verlust des Arbeitsplatzes baut eine hohe Mauer des Schweigens, die verhindert, dass rechtzeitig Hilfe gesucht wird.
Dabei ist die Anerkennung von Sucht als Krankheit keine neue Erkenntnis, sondern hat in Deutschland eine lange juristische Tradition. In einem bahnbrechenden Urteil stellte das Bundessozialgericht bereits am 18. Juni 1968 klar, dass Alkoholabhängigkeit als Krankheit im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung anzusehen ist. Dieser Richterspruch war ein Meilenstein. Er öffnete den Weg für die Kostenübernahme von Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen durch die Sozialversicherungsträger und verankerte das Krankheitsmodell rechtlich. Seither haben Betroffene einen Anspruch auf Behandlung, genau wie bei Diabetes oder Herzerkrankungen.
Doch die soziale Realität hinkt der rechtlichen Anerkennung um Jahrzehnte hinterher. Das Wort „Süchtiger“ ist nach wie vor negativ besetzt und wird mit Willensschwäche und Unzuverlässigkeit assoziiert. Um dieser Stigmatisierung entgegenzuwirken, bevorzugt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrer internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD) den Begriff „Abhängigkeitssyndrom“. Damit soll verdeutlicht werden, dass es sich um eine Krankheit mit klar definierten diagnostischen Kriterien handelt. Die Scham führt dazu, dass Betroffene ihre Erkrankung oft jahrelang selbst vor engsten Vertrauten verbergen. Sie werden zu Meistern der Tarnung, was die Abwärtsspirale nur noch beschleunigt und den Leidensdruck ins Unermessliche steigert.
Ohne Einsicht keine Heilung: Warum die Akzeptanz der Krankheit der erste Schritt zur Genesung ist
Der Weg aus der Sucht beginnt nicht mit dem letzten Drink oder der letzten Dosis, sondern mit einem entscheidenden Moment der inneren Kapitulation: der Akzeptanz. Solange ein Betroffener glaubt, „alles im Griff“ zu haben oder das Problem jederzeit allein lösen zu können, ist jede Intervention zum Scheitern verurteilt. Die Einsicht, an einer Krankheit zu leiden, die man nicht allein durch Willenskraft besiegen kann, ist der Wendepunkt. Diese Akzeptanz ist keine Schwäche, sondern der mutigste und wichtigste Schritt auf dem Weg zur Genesung.
Für viele Angehörige ist dieser Punkt schwer zu verstehen. Sie sehen das destruktive Verhalten und appellieren an die Vernunft, ohne zu erkennen, dass die Krankheit eben jene Vernunft blockiert. Akzeptanz bedeutet für den Betroffenen, die Kontrolle abzugeben, um sie langfristig wiederzuerlangen. Es ist das Eingeständnis, Hilfe zu benötigen – von Ärzten, Therapeuten und Selbsthilfegruppen. Dieser Schritt bricht die Isolation und das Schweigen, die durch die Scham aufrechterhalten wurden. Erst wenn die Energie nicht mehr für die Verleugnung und das Versteckspiel aufgewendet wird, kann sie in den Heilungsprozess fliessen.

Wie dieser Weg aussehen kann, zeigt das eindrückliche Beispiel vieler ehemals Betroffener oder deren Kinder. Der Mut, die eigene Geschichte zu teilen und Hilfe anzunehmen, kann das Leben fundamental verändern. Nicolas, ein junger Mann aus einer suchtbelasteten Familie, fasst diese entscheidende Botschaft zusammen:
Sucht euch Hilfe. Du entscheidest, wie dein Leben läuft und nicht deine Eltern. Und du bist auch nicht schuld an ihrer Krankheit.
– Nicolas (23), engagiert für Kinder aus suchtbelasteten Familien
Diese Aussage ist ein kraftvoller Appell, die lähmende Schuld abzulegen und die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Die Akzeptanz der Krankheit ist der Schlüssel, der die Tür zu einem Netzwerk aus Unterstützung und professioneller Hilfe öffnet. Sie ist die Voraussetzung dafür, die Mechanismen der Sucht zu verstehen, neue Bewältigungsstrategien zu erlernen und letztendlich ein selbstbestimmtes Leben ohne die Fesseln der Abhängigkeit zu führen.
Die Anatomie des Verlangens: Was im Gehirn bei Sucht passiert
Um zu begreifen, warum der Wille allein gegen die Sucht so oft machtlos ist, müssen wir einen Blick ins Gehirn werfen. Das süchtige Verlangen, das sogenannte „Craving“, ist kein reines Gefühl, sondern ein tiefgreifender neurobiologischer Prozess, der die Architektur unseres Denk- und Steuerungsorgans verändert. Im Zentrum steht das mesolimbische System, besser bekannt als das Belohnungssystem. Es ist dafür verantwortlich, überlebenswichtiges Verhalten durch die Ausschüttung von Botenstoffen wie Dopamin zu verstärken. Doch Suchtmittel kapern dieses System und programmieren es um.
Die ständige, unnatürlich hohe Stimulation durch Drogen oder süchtiges Verhalten führt zu einer fatalen Anpassung. Das Gehirn reduziert die Anzahl der Dopamin-Rezeptoren, um sich vor der Reizüberflutung zu schützen. Die Folge: Natürliche Freuden wie ein gutes Essen oder soziale Interaktion lösen kaum noch ein Belohnungsgefühl aus. Die Welt wird grau und nur das Suchtmittel kann das System noch ausreichend aktivieren. Gleichzeitig wird das Gleichgewicht anderer wichtiger Neurotransmitter gestört. Forschung zeigt, dass die Interaktion zwischen dem „Glückshormon“ Dopamin und dem erregenden Botenstoff Glutamat entscheidend ist. Sucht verschiebt dieses Gleichgewicht zugunsten von Glutamat, was zu einer Übererregbarkeit des Systems führt und das zwanghafte Verlangen verstärkt.
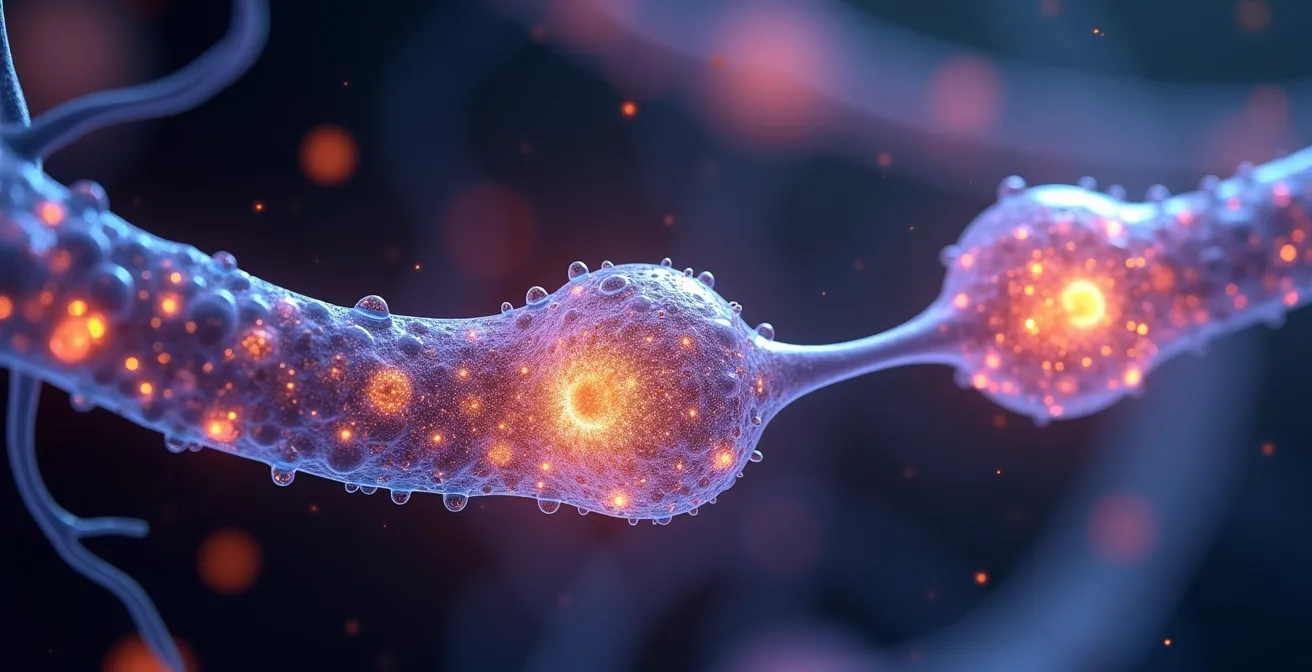
Diese neurochemische Entgleisung ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Die andere ist die strukturelle Veränderung des Gehirns. Glücklicherweise ist unser Gehirn nicht starr, sondern ein Leben lang formbar. Dieses Phänomen nennt sich Neuroplastizität. So wie die Sucht negative Bahnen und Verknüpfungen im Gehirn geschaffen hat, kann die Therapie helfen, neue, gesunde Verbindungen aufzubauen. Langfristige Abstinenz, Psychotherapie und das Erlernen neuer Verhaltensweisen können die Gehirnstruktur und -funktion nachweislich wieder normalisieren. Das Gehirn lernt, auch ohne das Suchtmittel wieder Freude zu empfinden. Dieser Prozess ist langwierig und erfordert viel Training, aber er beweist: Heilung von Sucht ist auch auf biologischer Ebene möglich.
„Ich habe alles im Griff“: Die Psychologie der Verleugnung bei Suchterkrankungen
Einer der verwirrendsten und frustrierendsten Aspekte für Angehörige ist die hartnäckige Verleugnung der Betroffenen. Obwohl die negativen Konsequenzen – Jobverlust, Beziehungskrisen, gesundheitliche Probleme – offensichtlich sind, halten viele an der Überzeugung fest: „Ich habe kein Problem“ oder „Ich kann jederzeit aufhören“. Diese Verleugnung ist keine bewusste Lüge, sondern ein mächtiger psychologischer Abwehrmechanismus. Er schützt den Betroffenen vor der unerträglichen Wahrheit und der damit verbundenen Scham.
Die Verleugnung erfüllt eine wichtige, wenn auch destruktive Funktion: Sie hält das fragile Selbstbild aufrecht. Sich einzugestehen, die Kontrolle über das eigene Leben verloren zu haben, würde eine massive narzisstische Kränkung bedeuten. Die kognitive Dissonanz – der Widerspruch zwischen dem eigenen Handeln und dem Wissen um dessen Schädlichkeit – wird so gross, dass das Gehirn nach Auswegen sucht. Es bagatellisiert („So schlimm ist es nicht“), rationalisiert („Ich brauche das zum Stressabbau“) oder projiziert die Schuld auf andere („Mein Chef ist schuld, dass ich trinke“). Diese Verzerrung der Realität ermöglicht es, den Konsum fortzusetzen, ohne psychisch zusammenzubrechen.
Ein entscheidender Faktor, der die Verleugnung oft unbewusst verstärkt, ist die Co-Abhängigkeit von nahestehenden Personen. Angehörige, die aus Liebe oder Angst die Konsequenzen der Sucht vom Betroffenen fernhalten – indem sie ihn bei der Arbeit krankmelden, seine Schulden bezahlen oder seine Ausfälle entschuldigen –, verhindern, dass der Leidensdruck ein Niveau erreicht, das die Verleugnung durchbrechen könnte. Wie offizielle Stellen betonen, ist ein wichtiger Schritt aus der Co-Abhängigkeit, sich einzugestehen, alleine nicht weiterzuwissen und selbst Hilfe bei Suchtberatungsstellen zu suchen. Indem Angehörige lernen, Grenzen zu setzen, helfen sie nicht nur sich selbst, sondern zwingen auch den Betroffenen, sich der Realität seiner Krankheit zu stellen. Die Diskrepanz zwischen dem Ausmass des Problems und der Inanspruchnahme von Hilfe wird auch durch Behandlungsstatistiken untermauert, welche den Handlungsbedarf verdeutlichen.
Das Wichtigste in Kürze
- Sucht ist keine Charakterschwäche, sondern eine anerkannte, chronische Gehirnerkrankung, die das Belohnungs- und Kontrollsystem betrifft.
- Der Übergang von Genuss zu Zwang ist ein neurobiologischer Prozess, bei dem automatisierte Gewohnheiten die bewusste Steuerung übernehmen („Gewohnheits-Autobahn“).
- Scham und die daraus resultierende Verleugnung sind zentrale Symptome der Krankheit und die grössten Hindernisse auf dem Weg zur Hilfesuche und Genesung.
Die Psyche im Griff der Sucht: Wie Abhängigkeit das Denken, Fühlen und die Persönlichkeit verändert
Die tiefgreifendste und vielleicht tragischste Folge einer Suchterkrankung ist nicht der körperliche Verfall, sondern die schleichende Veränderung der Persönlichkeit. Die Abhängigkeit untergräbt die Fähigkeit, klar zu denken, angemessen zu fühlen und wertebasiert zu handeln. Das „Ich“ wird zunehmend vom Diktat der Sucht bestimmt. Dieses Phänomen ist keine moralische Erosion, sondern die direkte Konsequenz der neurobiologischen Veränderungen im Gehirn, die das gesamte psychische Erleben neu justieren.
Auf kognitiver Ebene führt die Sucht zu einer extremen Einengung der Wahrnehmung. Das Denken kreist zwanghaft um das Suchtmittel: Wie beschaffe ich es? Wann kann ich konsumieren? Wie verheimliche ich es? Andere Lebensbereiche wie Familie, Hobbys oder berufliche Ziele treten in den Hintergrund. Gleichzeitig wird die Fähigkeit zur Impulskontrolle und zur rationalen Entscheidungsfindung, die im präfrontalen Kortex verortet ist, massiv geschwächt. Wie Dr. Sabine Vollstädt-Klein vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim es treffend beschreibt, findet eine regelrechte „Entführung“ statt:
Bei Suchtpatienten kann das mesolimbische System durch Bottom-Up-Prozesse den präfrontalen Cortex sozusagen ‚kidnappen‘. Reflexe, Gewohnheiten und drängendes Verlangen nehmen dann überhand.
– Dr. Sabine Vollstädt-Klein, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim
Emotional erleben Betroffene oft eine Achterbahnfahrt extremer Zustände, von der künstlichen Euphorie im Rausch bis zur tiefen Verzweiflung und Leere in den Phasen dazwischen. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation geht verloren. Das Suchtmittel wird zur einzigen bekannten Methode, um mit Stress, Trauer oder Angst umzugehen. Diese Veränderungen betreffen Millionen von Menschen. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass allein in Deutschland rund 7 Millionen Erwachsene abhängig sind, davon der grösste Teil von legalen Substanzen wie Tabak und Alkohol. Diese Zahlen verdeutlichen das immense Ausmass des Leids, das sich hinter den Statistiken verbirgt.
Das Verständnis von Sucht als einer komplexen Gehirnerkrankung ist der erste und wichtigste Schritt, um die Mauern aus Scham, Schuld und Stigmatisierung einzureissen. Der Weg zur Heilung ist möglich, aber er erfordert professionelle Unterstützung. Wenn Sie oder jemand in Ihrem Umfeld betroffen sind, ist Handeln der nächste logische Schritt. Informieren Sie sich bei professionellen Suchtberatungsstellen, um sich selbst und den betroffenen Menschen wirksam zu unterstützen.